Kleinreparaturklausel im Mietvertrag
Lesedauer: ca. 6 Minuten
Die Kleinreparaturklausel im Mietvertrag ist ein Thema, das immer wieder Fragen aufwirft. Darf der Vermieter kleine Schäden einfach auf den Mieter abwälzen? Und wenn ja, in welchem Umfang? Viele Eigentümer sind unsicher, wie weit ihre Rechte tatsächlich reichen und welche Formulierungen in Mietverträgen rechtlich wirksam sind. Gleichzeitig fragen sich Mieter, welche Kosten sie übernehmen müssen und wo ihre Pflichten enden.
Gerade weil die Summen auf den ersten Blick überschaubar wirken, unterschätzen viele Beteiligte die Bedeutung dieser Klauseln. Doch schon kleine Formfehler können dazu führen, dass eine Regelung komplett unwirksam ist – mit finanziellen Folgen für den Vermieter. Dieser Beitrag erklärt Schritt für Schritt, was als Kleinreparatur gilt, wie hoch die Kostenbeteiligung sein darf, wann Klauseln unwirksam sind und wer die Kosten trägt, wenn keine entsprechende Vereinbarung existiert.
Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar. Er kann und soll eine individuelle rechtliche Beratung nicht ersetzen. Für verbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an einen Fachanwalt für Mietrecht oder eine qualifizierte Beratungsstelle.
1. Was genau gilt als Kleinreparatur im Mietvertrag?
Unter den Begriff der Kleinreparatur fallen ausschließlich kleinere Schäden an Gegenständen, die dem häufigen und unmittelbaren Zugriff des Mieters unterliegen. Typische Beispiele sind der tropfende Wasserhahn, ein defekter Lichtschalter, der Türgriff, der ausgetauscht werden muss, oder die Dichtung an einem Fenstergriff. Entscheidend ist, dass es sich um Teile handelt, die durch den alltäglichen Gebrauch beansprucht werden und die vom Mieter ohne großen Aufwand bedient werden können.
Nicht unter die Kleinreparaturregelung fallen dagegen bauliche Elemente oder zentrale Installationen wie Heizungsanlagen, Dachkonstruktionen oder Rohrleitungen, die in der Wand verlaufen. Hier ist die Grenze klar: Je komplexer und kostenintensiver die Reparatur ausfällt, desto eher liegt die Verantwortung vollständig beim Vermieter.
Damit eine Reparatur überhaupt als Kleinreparatur gilt, müssen zwei Kriterien erfüllt sein: Zum einen muss es sich um einen kleinen, einfach zu behebenden Schaden handeln, der in direktem Zusammenhang mit der Nutzung durch den Mieter steht. Zum anderen darf der Aufwand zur Beseitigung des Schadens nicht erheblich sein.
Gerichte haben im Laufe der Zeit zahlreiche Abgrenzungen getroffen, um Klarheit zu schaffen. So gilt beispielsweise der Austausch einer WC-Spülung oder eines Wasserhahns als Kleinreparatur, während ein Heizkörper oder eine komplette Elektroinstallation nicht darunterfallen. Für Vermieter bedeutet das: Nur solche Schäden, die tatsächlich durch den regelmäßigen Gebrauch verursacht werden und sich mit überschaubarem Aufwand reparieren lassen, dürfen in den Anwendungsbereich der Kleinreparaturklausel aufgenommen werden.
2. Wie hoch darf die maximale Kostenübernahme pro Kleinreparatur sein?
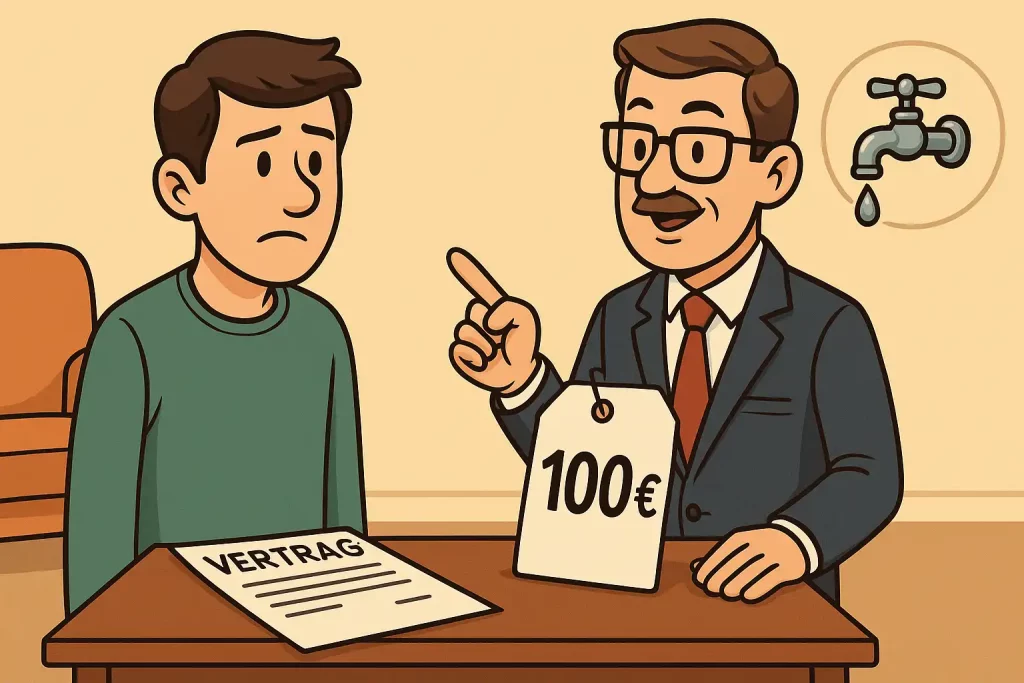
Selbst wenn eine Klausel im Mietvertrag grundsätzlich wirksam ist, gibt es klare Grenzen, was die Höhe der Kosten angeht. Nach ständiger Rechtsprechung dürfen Mieter nur bis zu einem bestimmten Betrag pro Reparatur belastet werden. Dieser liegt in der Regel zwischen 75 und 100 Euro. Beträge, die darüber hinausgehen, werden von vielen Gerichten als unangemessen und damit unwirksam eingestuft.
Neben der Grenze für die einzelne Reparatur spielt auch die jährliche Gesamtsumme eine Rolle. Üblich ist eine Obergrenze von etwa 6 bis 8 Prozent der Jahresnettokaltmiete. Das bedeutet: Selbst wenn mehrere kleine Schäden auftreten, darf der Mieter insgesamt nicht über diesen Betrag hinaus belastet werden. Alles, was darüber liegt, muss der Vermieter selbst übernehmen.
Diese Regelungen haben einen klaren Hintergrund: Kleinreparaturklauseln sollen den Vermieter entlasten, ohne den Mieter über Gebühr zu belasten. Werden die Beträge zu hoch angesetzt, liegt keine ausgewogene Risikoverteilung mehr vor. Daher ist es für Vermieter entscheidend, die Kostenobergrenzen einzuhalten, um die Wirksamkeit der Klausel nicht zu gefährden.
3. Welche Klauseln zur Kleinreparatur sind unwirksam?
Nicht jede Formulierung im Mietvertrag ist automatisch rechtlich wirksam. Gerade bei der Kleinreparaturklausel zeigt sich, dass unklare oder zu weit gefasste Bestimmungen regelmäßig von Gerichten kassiert werden. Ein häufiger Fehler ist, dass der Mieter zur Übernahme von Reparaturen verpflichtet werden soll, die gar nicht in seinem direkten Einflussbereich liegen. Dazu gehören etwa Schäden an Heizkesseln, Rohrleitungen in der Wand oder Dachfenstern. Solche Regelungen sind unwirksam, weil sie die Pflichten des Mieters unverhältnismäßig ausweiten.
Ebenso problematisch sind Klauseln, die keine klare Kostenobergrenze enthalten. Wird lediglich von „angemessenen Kosten“ gesprochen, fehlt es an einer objektiven Grenze. Ohne genaue Beträge ist die Klausel intransparent und damit unwirksam. Dasselbe gilt, wenn die zulässige Maximalsumme pro Reparatur oder die jährliche Gesamtobergrenze nicht eindeutig benannt wird.
Ein weiteres Risiko besteht darin, wenn Vermieter versuchen, die Kleinreparaturklausel auf nahezu alle in der Wohnung vorhandenen Einrichtungen auszudehnen. Gerade bei teuren Elektrogeräten oder fest verbauten technischen Anlagen fehlt es dann an der für Kleinreparaturen typischen Alltäglichkeit und Geringfügigkeit.
Die Rechtsprechung zeigt deutlich: Kleinreparaturklauseln müssen klar formuliert, inhaltlich begrenzt und für den Mieter verständlich sein. Schon kleine Abweichungen von diesen Grundsätzen können dazu führen, dass die gesamte Regelung unwirksam wird. Für Vermieter bedeutet das nicht nur Rechtsunsicherheit, sondern auch die Pflicht, sämtliche Reparaturkosten allein zu tragen – selbst wenn der Schaden durch intensiven Gebrauch des Mieters entstanden ist.
4. Muss der Mieter mehrere kleine Reparaturen gleichzeitig zahlen?

In der Praxis stellt sich oft die Frage, wie mit einer Häufung kleiner Schäden umzugehen ist. Muss ein Mieter wirklich mehrere Reparaturen übernehmen, wenn sie innerhalb kurzer Zeit auftreten? Grundsätzlich gilt: Solange jede einzelne Reparatur die vereinbarte Kostenobergrenze nicht überschreitet und die jährliche Gesamtsumme eingehalten wird, kann der Vermieter die Kosten auf den Mieter umlegen.
Allerdings gibt es auch hier Grenzen. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass eine zu hohe Belastung unzumutbar ist. Wenn innerhalb weniger Wochen zahlreiche Schäden auftreten, die zwar jeweils unter der Einzelgrenze liegen, in der Summe aber die Jahresobergrenze überschreiten, ist der Mieter nicht mehr verpflichtet, alle Kosten zu tragen.
Zudem ist zu beachten, dass Vermieter nicht mehrere kleine Reparaturen künstlich zusammenfassen dürfen, um so höhere Beträge geltend zu machen. Jeder Schaden muss einzeln betrachtet werden. Eine defekte Dichtung und ein kaputter Türgriff sind zwei separate Reparaturen – und dürfen nicht pauschal zu einer „größeren“ Reparatur erklärt werden.
Für Vermieter ist es deshalb wichtig, nicht nur die Einzelbeträge im Blick zu behalten, sondern auch die jährliche Gesamtbelastung. Nur so lässt sich vermeiden, dass die Klausel in einem Streitfall für unwirksam erklärt wird.
5. Gilt die Kleinreparaturklausel auch für Elektrogeräte?
Ein besonders häufiger Streitpunkt ist die Frage, ob Elektrogeräte in den Anwendungsbereich der Kleinreparaturklausel fallen. Grundsätzlich gilt: Nur fest mit der Wohnung verbundene Geräte können überhaupt von der Klausel erfasst sein. Dazu zählen zum Beispiel der im Mietobjekt eingebaute Herd, die Dunstabzugshaube oder eine fest installierte Beleuchtung. Bewegliche Geräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke oder Geschirrspüler, die der Vermieter lediglich mitvermietet, fallen in der Regel nicht darunter.
Der Grund dafür liegt in der Abgrenzung: Kleinreparaturen sollen lediglich den Austausch oder die Instandsetzung einfacher Teile betreffen, die durch den täglichen Gebrauch verschleißen. Bei größeren oder komplexeren Elektrogeräten handelt es sich jedoch nicht mehr um geringfügige Reparaturen. Auch die Kosten überschreiten in den meisten Fällen die zulässige Obergrenze, sodass eine Umlage auf den Mieter ohnehin unzulässig wäre.
Vermieter sollten daher vorsichtig sein, wenn sie versuchen, Elektrogeräte in die Kleinreparaturklausel einzubeziehen. Eine zu weit gefasste Formulierung kann zur kompletten Unwirksamkeit führen. Sicherer ist es, solche Geräte gesondert zu regeln oder vertraglich klarzustellen, dass die Verantwortung für deren Instandhaltung beim Vermieter liegt. Für Mieter bedeutet das wiederum, dass sie in den meisten Fällen nicht für Reparaturen oder Ersatz von Elektrogeräten aufkommen müssen.
6. Wer zahlt, wenn keine Kleinreparaturklausel im Mietvertrag steht?

Fehlt im Mietvertrag eine wirksame Kleinreparaturklausel, ist die Rechtslage eindeutig: Sämtliche Reparaturkosten trägt der Vermieter – unabhängig davon, ob es sich um kleine oder große Schäden handelt. Der Grund dafür ist, dass der Vermieter nach dem Gesetz verpflichtet ist, die Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten. Dazu gehört auch die Übernahme der Kosten für die Beseitigung von Mängeln, die durch normalen Gebrauch entstehen.
Für Mieter ist das eine klare Position: Sie müssen weder die Kosten für tropfende Wasserhähne noch für defekte Türschlösser übernehmen. Vermieter dagegen riskieren, selbst für Kleinstbeträge aufkommen zu müssen, wenn sie die Kleinreparaturregelung nicht korrekt in den Mietvertrag aufgenommen haben.
Gerade für Eigentümer mit mehreren Wohneinheiten kann dies schnell teuer werden, da kleine Schäden in der Summe hohe Kosten verursachen können. Deshalb ist es sinnvoll, die Verträge regelmäßig zu prüfen und sicherzustellen, dass eine rechtssichere Kleinreparaturklausel enthalten ist.
Werden neue Mietverträge aufgesetzt, sollte auf eine präzise Formulierung mit klaren Grenzen geachtet werden. So lassen sich spätere Streitigkeiten vermeiden und die Kostenverteilung bleibt transparent. Fehlt die Klausel, bleibt dem Vermieter keine andere Wahl, als sämtliche Reparaturen selbst zu bezahlen.
7. Fazit
Die Kleinreparaturklausel im Mietvertrag ist ein scheinbar kleines Detail, das in der Praxis jedoch große Auswirkungen hat. Sie regelt, welche kleineren Schäden der Mieter übernehmen muss und wo die Verantwortung eindeutig beim Vermieter liegt. Entscheidend ist, dass die Klausel klar formuliert, inhaltlich begrenzt und mit transparenten Kostenobergrenzen versehen ist. Nur dann ist sie rechtlich wirksam und schützt den Vermieter vor unnötigen Belastungen.
Für Mieter bedeutet eine wirksame Klausel, dass sie für bestimmte Reparaturen zahlen müssen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen – jedoch nur in einem finanziell überschaubaren Rahmen. Unwirksame oder fehlende Regelungen führen dagegen dazu, dass sämtliche Kosten beim Vermieter verbleiben.
Wer als Eigentümer seine Mietverträge regelmäßig überprüft und rechtssicher gestaltet, schafft damit nicht nur Klarheit, sondern auch ein stabiles Verhältnis zu den Mietern. Eine faire und transparente Verteilung der Kosten ist die Grundlage für ein gutes Mietverhältnis und vermeidet Streit.
